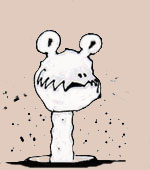Der Herbst hat Einzug gehalten in Wien und mit ihm verdichten sich auch die nennenswerten kulturellen Veranstaltungen. Nach einem denkwürdigen Konzert von Conor Oberst im September, beginnt der Oktober mit einem herzerwärmenden Theaterabend. Eine Bühne im 15. Wiener Gemeindebezirk, der so genannte Salon 5, zeichnet dafür verantwortlich. Für mich persönlich wenig überraschend, da mich der letzte Besuch im Burgtheater, der auch schon wieder fast ein Jahr zurückliegt, wahrlich nicht vom Hocker gerissen und meine Meinung gefestigt hat, dass die hochnotwendige Theaterrevolution sicherlich nicht dort stattfinden wird, zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Ein kleines, flexibles, Innovationen aufgeschlossen gegenüberstehendes Bühnenprojekt, das auch vor dem Kontakt mit dem Publikum nicht zurückschreckt – der Salon 5 – scheint diesbezüglich schon einiges mehr an Potential zu beherbergen.
Nachdem mir zu Beginn des Jahres Fortuna hold war und mir einen Besucherpass, der mich samt Begleitung zu ganzen drei Vorstellungsbesuchen einlud, ins elektronische Postfach wehte, hat es New York-bedingt bis Oktober gedauert, bis mich mein Weg gestern Abend endlich in die Fünfhausgasse 5 führte. Am Spielplan stand „Ich und Kaminski“ nach einem Roman von Daniel Kehlmann, den ich zugegebenermaßen nicht gelesen habe.
Bereits der erste Eindruck der Spielstätte war ausgenommen positiv. Durch einen Durchgang geht es in einen hübschen Innenhof, der den Blick auf die herrliche Ziegelfassade der Spielstätte freigibt. Das Erdgeschoß bildet ein offener loftartiger Raum, in dem man sich bei herzlicher Bewirtung und gratis (!) Tapas auf die Vorstellung einstimmen kann. Es gibt noch einen ausgesprochen einladenden Innenhof, der Einen laue Sommernächte herbeiwünschen lässt, um hier gemütlich zu loungen. Das Gebäude ist Teil des ehemaligen jüdischen Sportvereins Makkabi, wurde geschmackvoll renoviert und wird jetzt von Brick 5, dem Verein zur Förderung der multimedialen Kunst und Technik, betrieben. Es gäbe vermutlich, allein die Geschichte des Hauses betreffend, einiges zu sagen, ich ziehe es für den Moment vor, mich über die dort stattfindende Theaterkunst auszubreiten.

Die Vorstellung beginnt bereits in der Lounge, an Ort und Stelle werden die Protagonisten vorstellig und unvermutet befindet man sich mitten im Geschehen. Nach der Aufwärmrunde begibt man sich samt und sonders in den ersten Stock, in dem eine ebenerdige schmale Bühne sich an die hintere Raumwand schmiegt. Der Boden ist mit feinem Sand bedeckt, an der Wand hängen Bilder, die zugleich als Projektionsfläche dienen, sowie eine größere Videowand, der im Laufe der Vorstellung nicht unbeträchtliche Wichtigkeit zukommt. Das Stück handelt von Sebastian Zöllner (Daniel Frantisek Kamen), seines Zeichens Kunstkritiker und Biograph, der sich mit der Biographie des alternden Kunststars Manuel Kaminski (Isabella Wolf) selbst ein Denkmal setzen möchte. Zwischen Rückblenden auf die Recherchearbeit des selbstgefälligen Zöllner, in denen via Videowall dessen Interviewpartner mehr oder weniger willig Einblicke in das vermeintliche Leben des Kaminski geben und den Dialogen mit dem kränkelnden, altersschwachen Künstler und dessen Tochter (ebenfalls Isabella Wolf) begibt sich der Besucher auf eine Reise, auf der ganz nebenbei Fragen nach Identität, Sein und Schein, Geltungsdrang und Lebenszweck aufgegriffen werden. Aufgelockert wird das Ganze durch eine dynamische Spielführung, in der so gut wie nie Langeweile aufkommt, dem vollen (körperlichen) Einsatz der drei Darsteller (Jens Ole Schmieder ist der Dritte im Bunde) und den Video-Gastauftritten prominenter Schauspieler.
Nach dem gerne und großzügig spendierten Applaus begibt man sich zurück in die Lounge und trifft, welch nette Überraschung, auf die Schauspieler selber. Hat Gelegenheit nachzufragen, sich bei einem Glas Wein noch mal in die Thematik des Stückes zu vertiefen, oder über das Theater an sich zu philosophieren. Über die Freude, ein diesbezügliches Juwel, noch dazu in Wien, entdeckt zu haben, über die innovative Inszenierung (Bühnenfassung und Regie: Anna Maria Krassnigg), über alles was in der hiesigen Kulturszene falsch läuft und die unfassbare Frechheit, dass ein Projekt wie dieses, wenn es blöd läuft, ab dem nächsten Frühjahr nicht mehr gefördert wird. Das gilt es zu verhindern! Ich zumindest werde meine zwei verbleibenden Besuche in jedem Fall konsumieren, ein Abonnement fürs nächste Jahr ist ins Auge gefasst und für alle, die den Weg in den Salon 5 noch nicht gefunden haben: Allerwärmste Empfehlung!
Weiterführende Links:
Susanne, 12. Oktober 2008